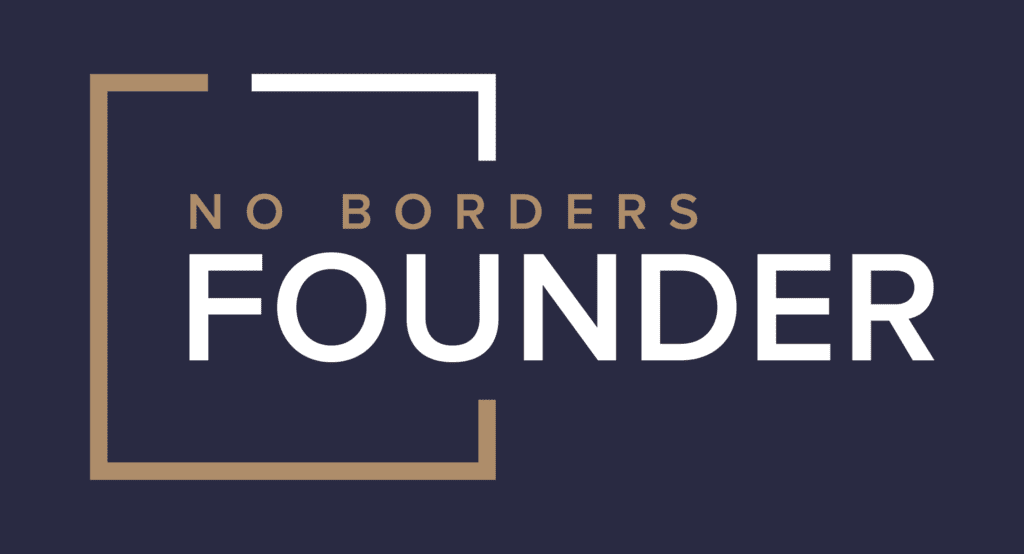Meinungsfreiheit 2025: Wie Europa die Kontrolle übernimmt – und Unternehmer schweigen lernen

Dieses Whitepaper enthüllt mit Daten, Gesetzen und Fallstudien, wie die Meinungsfreiheit in Deutschland systematisch ausgehöhlt wird – und warum Unternehmer, Investoren und Freidenker jetzt handeln müssen, bevor es zu spät ist.
Verfasst von: Alexander Erber, Senior Consultant & Strategieberater
April 2025
Wenn Meinung zur Gefahr wird – und Schweigen zur Compliance
Es beginnt nicht mit einem Verbot. Es beginnt mit einer Löschung.
Mit einem Like, der zu einer Hausdurchsuchung führt. Mit einem Kommentar, der einen Shitstorm auslöst. Mit einem Gespräch, bei dem man innehält – aus Angst, jemand könnte mithören.
„Ich habe nie beraten, um zu gefallen. Ich berate, damit meine Klienten frei bleiben.“
– Alexander Erber
Ich schreibe dieses Whitepaper nicht als Jurist. Nicht als Journalist.
Ich schreibe es als jemand, der seit Jahren Unternehmer, Freidenker, Expats, Hochvermögende und globale Strategen dabei begleitet, frei zu denken, frei zu leben – und strategisch zu handeln.
Und was ich beobachte, ist beunruhigend: Die Meinungsfreiheit stirbt. Nicht laut, nicht abrupt, nicht mit einem Putsch. Sondern schleichend.
Unter dem Deckmantel des Guten. Im Namen der „Sicherheit“. Im Zeichen des digitalen Fortschritts.
In Deutschland – dem Land, das Meinungsfreiheit angeblich wie ein Heiligtum schützt – trauen sich 60 % der Bürger nicht mehr, ihre Meinung zu sagen.
Das ist kein Bauchgefühl, sondern ein offizielles Ergebnis der Allensbach-Studie 2023. Ein historischer Tiefpunkt.
Ich sehe Unternehmer, die LinkedIn-Profile säubern.
Klienten, die ihre Statements durch Rechtsabteilungen prüfen lassen.
Journalisten, die sich selbst zensieren.
Und einfache Bürger, die nachts ihre Kommentare löschen – aus Angst vor Konsequenzen.
Dieses Whitepaper zeigt auf, was wirklich passiert – auf Basis von offiziellen Zahlen, Primärquellen, Gesetzen und konkreten Fallbeispielen.
Es ist kein Aufschrei. Es ist ein Weckruf. Für alle, die noch selbst denken – und noch selbst entscheiden wollen, was sie sagen dürfen.
Vom Grundrecht zur Erlaubnis
Wie ein fundamentales Freiheitsrecht in Deutschland still untergraben wird
1.1 – Artikel 5 GG: Ein leerer Rahmen?
Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes beginnt eindeutig:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“
Doch in der Praxis sieht es anders aus.
Zahlreiche Gesetze, Richtlinien und Plattform-Regeln setzen dieses Grundrecht immer stärker unter Druck.
Beispiele:
-
§ 130 StGB (Volksverhetzung): Seit 2021 erweitert auf Themen wie „Relativierung von Migrationspolitik“
-
§ 188 StGB (Beleidigung von Amtsträgern): Strafverschärfung bei Kritik an Politikern
-
NetzDG: Verpflichtet Plattformen, „rechtswidrige Inhalte“ binnen 24 Stunden zu löschen – ohne richterliche Prüfung
-
Digital Services Act (DSA): Seit Februar 2024 EU-weit gültig – Löschung auf Verdacht, hohe Bußgelder bei „Nicht-Kooperation“
Das Problem: Diese Gesetze enthalten unscharfe Begriffe wie „Hass“, „Hetze“, „Desinformation“, die oft willkürlich ausgelegt werden.
1.2 – ZDF: Zahlen, Daten, Fakten zur schleichenden Einschränkung
Allensbach-Studie 2023:
-
Nur noch 40 % der Deutschen glauben, ihre Meinung frei äußern zu können.
-
1987 waren es noch 78 %.
Civicus Monitor 2024:
-
Deutschland wird nur noch als „beeinträchtigt“ geführt (vormals „offen“)
-
Begründung: „staatlich geförderte Repression gegen Protestformen“, „vage Strafgesetze“
Freedom House – Freedom on the Net 2024:
-
Deutschland rutscht von 80 auf 76 Punkte
-
Kritik: „Expansion of legal liabilities for online speech“
Statista 2024:
-
Über 94.000 Löschanfragen an Social-Media-Plattformen in Deutschland allein im Jahr 2023
-
Anstieg von +118 % seit 2020
Bundesinnenministerium:
-
Mehr als 1.300 Hausdurchsuchungen wegen Online-Äußerungen im Jahr 2023
-
Häufigste Grundlage: § 188 StGB
1.3 – Fallstudien: Wenn Meinung zur Anzeige wird
Fall 1:
Ein mittelständischer Unternehmer kommentiert auf Facebook ein Video von Bundesminister Robert Habeck mit den Worten:
„So eine Politik macht unser Land kaputt.“
Folge: Anzeige wegen § 188 StGB („Beleidigung eines Amtsträgers“)
Ergebnis: Hausdurchsuchung, Handy beschlagnahmt, Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Fall 2:
Eine Influencerin postet ein Video über Migration in Europa – sachlich, aber kritisch.
Instagram löscht das Video, wegen „Verstoß gegen Gemeinschaftsrichtlinien“.
Kurz darauf verliert sie drei Werbepartner.
Begründung: „Imagegefährdung für unsere Marke.“
1.4 – Plattformmacht ersetzt Rechtsstaat
Ein zentrales Problem: Nicht mehr Gerichte entscheiden über Recht – sondern Algorithmen und Community Guidelines.
Meta, X, YouTube & Co. erhalten über das NetzDG und den DSA die gesetzliche Pflicht, Inhalte zu löschen.
Aber: Sie dürfen selbst entscheiden, was „offensichtlich rechtswidrig“ ist.
Dabei entstehen systematische Fehler, auch „Overblocking“ genannt.
„Plattformen entwickeln sich zu digitalen Exekutivorganen ohne Kontrolle.“
– Prof. Dr. Udo Di Fabio, Verfassungsrechtler
Beispiel:
Eine harmlose Aussage wie „Ich habe Zweifel am Klimawandel“ wird gelöscht.
Gleichzeitig bleibt ein Aufruf zu Gewalt gegen politische Gegner online – weil er algorithmisch nicht erkannt wird.
1.5 – Die neue Compliance: Selbstzensur
Unternehmen reagieren. Sie schulen ihre Mitarbeiter in „Digitaler Sprachethik“.
Sie verbieten politische Äußerungen im Intranet.
Sie lassen Pressemitteilungen durch PR-Abteilungen „glätten“.
„Die Wahrheit hat in unserem Unternehmen keine Freigabe – wenn sie nicht mainstream-kompatibel ist.“ – Anonymer Geschäftsführer eines Tech-Unternehmens, 2024
Immer mehr Unternehmer denken nicht mehr in Strategie – sondern in Risikovermeidung.
Sie passen Sprache, Verhalten und Präsenz so an, dass sie gesellschaftlich unauffällig sind.
1.6 – Juristische Analyse: Der Druck von oben
Verfassungsrechtlich ist die Lage eindeutig:
Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht – mit Schranken.
Doch die Schranken werden enger. Und sie wirken asymmetrisch:
-
Kritik an Regierung = Anzeige
-
Kritik an Opposition = Toleranz
-
Ironie = potenzieller Rechtsbruch
-
Kritik an Migration = „Volksverhetzung“
-
Kritik an Maßnahmen = „Delegitimierung des Staates“
Zitat:
„Der Rechtsstaat zieht Grenzen – aber zunehmend selektiv.“
– Prof. Hans-Jürgen Papier, Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichts
1.7 – Fazit: Die Freiheit verkommt zur Fassade
Wir stehen an einem Punkt, an dem man noch reden darf – aber nur, wenn man nichts sagt.
Meinungsfreiheit existiert – aber sie wird zur Erlaubnis, nicht mehr zum Recht.
„Was heute verschwiegen wird, entscheidet morgen über Ihre Sichtbarkeit, Ihre Kredite, Ihre Geschäftsbeziehungen – Ihre Existenz.“ – Alexander Erber
Regulierung statt Recht – Wie DSA, EMFA & NetzDG die Debatte strangulieren
„Der moderne Angriff auf die Meinungsfreiheit kommt nicht mehr durch Uniformierte. Er kommt durch PDF-Dateien, EU-Gesetzesvorlagen und Terms of Service.“ – Alexander Erber
2.1.1 – Die neue Architektur der Kontrolle
Meinungsfreiheit war einst ein Bollwerk gegen Macht. Heute wird sie durch ein neues, scheinbar harmloses Instrument ersetzt: digitale Gesetzgebung.
Die Europäische Union hat seit 2020 ein Netz aus Verordnungen und Richtlinien geschaffen, das in seiner Tiefe und Wirkung das klassische Verständnis von Meinungsäußerung fundamental verändert.
Dazu zählen insbesondere:
-
DSA – Digital Services Act (seit Februar 2024 in Kraft)
-
EMFA – European Media Freedom Act (verbindlich ab August 2025)
-
Erweiterungen des NetzDG in Deutschland
-
Uploadfilter-Verordnungen auf Plattformebene
Ziel laut EU: „Schutz vor Desinformation, Hassrede und Manipulation“.
Tatsächliche Wirkung: ein System automatisierter Löschung, Überwachung und Diskursverengung, das weder demokratisch kontrolliert noch rechtlich sauber ausbalanciert ist.
„Wer heute eine Plattform betreibt, ist Teil der Exekutive – ob er will oder nicht.“
– Prof. Matthias Bäcker, Verfassungsrechtler (Uni Mainz)
2.1.2 – DSA: Der digitale Hebel der EU
Der Digital Services Act (DSA) gilt seit Februar 2024 verbindlich für alle großen Plattformen in der EU – von Facebook über X (Twitter) bis YouTube.
Er verpflichtet Plattformbetreiber zu:
-
schneller Löschung „illegaler Inhalte“ – auch ohne richterlichen Beschluss
-
automatisierter Meldung von „Desinformation“ an EU-Behörden
-
transparenter Risikoberichterstattung zu gesellschaftlicher „Manipulation“
Doch das Problem liegt im Detail:
-
Begriffe wie „Desinformation“ oder „gesellschaftliche Risiken“ sind nicht definiert, sondern werden von Plattformen oder der EU-Kommission situationsabhängig ausgelegt
-
Plattformen unterliegen Bußgeldern bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes – ein massiver Anreiz zur Überregulierung
-
Betroffene erhalten keinen ordentlichen Rechtsweg, wenn ihr Inhalt gelöscht wird – auch dann nicht, wenn die Löschung durch eine algorithmische Fehlentscheidung erfolgt ist
Kernkritik von Digitalrechtsexperten:
Der DSA schafft ein Zwei-Klassen-System des Rechts: Plattformen urteilen und sanktionieren ohne Richter, ohne Einspruch, ohne Transparenz.
2.1.3 – EMFA: Medienfreiheit oder Mediensteuerung?
Der European Media Freedom Act (EMFA) soll laut EU-Kommission die Medienpluralität sichern. Doch auch hier zeigen sich massive Risiken für die Meinungsvielfalt.
Zentrale Elemente:
-
Zentrale Registrierung journalistischer Anbieter
-
Transparenzpflichten über Eigentümerstrukturen
-
Interventionsrechte gegen „staatlich beeinflusste Desinformation“
-
Algorithmuskontrollen bei öffentlich sichtbaren Medieninhalten
Das klingt gut – und ist gefährlich. Denn:
-
In vielen Mitgliedstaaten bedeutet dies, dass unabhängige alternative Medien nicht mehr frei agieren können
-
Plattformen werden verpflichtet, zugelassene Quellen bevorzugt anzuzeigen – was in der Praxis zu Rankingverzerrung führt
-
Behörden können Inhalte mit dem Argument „öffentlicher Schutz“ herabstufen oder blockieren
Die Verschmelzung von politischem Interesse und technischer Plattformkontrolle ist damit gesetzlich legitimiert – und genau das ist der Kern der modernen Zensur.
„Die EMFA wirkt wie eine Medienlizenz durch die Hintertür. Wer zu kritisch ist, verliert Sichtbarkeit – ohne offizielle Zensur.“ – Dr. Jörg Benedikt, Medienrechtler (2025)
2.1.4 – NetzDG 2.0: Die deutsche Sonderrolle
Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) war schon 2017 ein Vorreiter in Europa – und wurde in den letzten Jahren weiter verschärft:
-
Seit 2021 greifen Teile des DSA bereits über das NetzDG – die Löschpflichten wurden ausgeweitet
-
Plattformen müssen „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ binnen 24 Stunden löschen
-
Neu: Ausweitung auf Video-Plattformen, Cloud-Dienste und Diskussionsforen
Der Staat gibt die Definitionsmacht an Plattformen ab, übt aber über die Meldestellen und Bußgeldstellen faktisch Druck aus.
Ein Unternehmen, das Inhalte nicht löscht, muss mit Strafen bis zu 50 Millionen Euro rechnen.
Ergebnis: Die meisten Plattformen löschen auf Verdacht, statt rechtlich zu prüfen.
Overblocking wird zur neuen Norm.
Und niemand haftet – außer dem, der gesprochen hat.
2.1.5 – Kontrolle durch Unsichtbarkeit: Ranking-Algorithmen & Uploadfilter
Neben juristischen Instrumenten wirken technologische Systeme als Zensurverstärker:
-
Uploadfilter erkennen „potenziell problematische Inhalte“ bereits vor Veröffentlichung
-
Ranking-Algorithmen stufen unliebsame Beiträge herunter (Shadowbanning)
-
Transparenz gibt es keine: Welche Inhalte wie sortiert oder versteckt werden, ist Geschäftsgeheimnis
Besonders perfide: Inhalte werden nicht gelöscht, sondern unsichtbar gemacht.
Der Absender sieht seine Nachricht – aber niemand sonst.
2.1.6 – Fallbeispiele aus der Praxis: Wenn die EU zum Richter wird
Fallbeispiel 1 – Frankreich: Impfkritik = Sperre
Ein französischer Arzt postete im Jahr 2023 auf X einen Beitrag, in dem er die Langzeitwirkung von mRNA-Impfstoffen kritisch hinterfragte – basierend auf veröffentlichten Studien der EMA.
Die Plattform erhielt mehrere Meldungen über angeblich „medizinische Desinformation“.
Ergebnis:
-
Beitrag gelöscht
-
Account 7 Tage gesperrt
-
Keine Begründung außer Verweis auf „Verstoß gegen DSA-konforme Standards“
Das Brisante: Die Aussagen waren wissenschaftlich korrekt und mit Quellen versehen – aber die algorithmischen Filtersysteme entschieden gegen ihn.
Fallbeispiel 2 – Deutschland: Zitat von Cicero = „Hassrede“
Ein Unternehmer aus Bayern zitierte auf LinkedIn sinngemäß Cicero mit den Worten:
„Wenn der Staat seine Bürger fürchtet, gibt es Freiheit. Wenn die Bürger den Staat fürchten, gibt es Tyrannei.“
Ein Mitarbeiter meldete den Beitrag über die unternehmensinterne „Compliance-Hotline“.
Der Account wurde von LinkedIn gelöscht – Begründung: „Aufwiegelung gegen staatliche Organe“.
Dazu kam ein Anruf des Ordnungsamtes mit der Bitte, „sich zum Thema Äußerungen über demokratische Institutionen zu erklären“.
Der Unternehmer beendete seine LinkedIn-Präsenz dauerhaft.
Fallbeispiel 3 – Österreich: Artikel über Migration führt zu Anzeigen
Ein regionaler Blogger veröffentlichte im Januar 2024 einen Artikel über die Auswirkung von illegaler Migration auf kommunale Haushalte.
Obwohl der Artikel mit offiziellen Zahlen des Bundesamts für Statistik arbeitete, wurde er von zwei NGOs gemeldet – die Plattform entfernte ihn binnen 8 Stunden.
Später erhielt der Blogger eine Anzeige wegen „Verhetzung“, gestützt auf § 283 StGB AT.
Bis heute läuft ein Ermittlungsverfahren.
2.1.7 – Juristische Einschätzungen & internationale Kritik
Die Debatte um die neuen EU-Gesetze wird nicht nur auf Social Media geführt – sondern auch auf höchster rechtlicher und internationaler Ebene.
1. Deutsche Richtervereinigung (DJV), Statement 2024:
„Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Verbindung mit DSA-Regelungen hebelt in Teilen das grundgesetzlich verbriefte Recht auf freie Meinungsäußerung aus. Es schafft eine Vorzensorstruktur.“
2. UN-Sonderbeauftragter für Meinungsfreiheit, David Kaye (Bericht 2023):
„Die EU riskiert mit dem DSA und EMFA ein Modell zu etablieren, das autoritäre Staaten kopieren werden.“
3. Europäischer Anwaltsverband (CCBE), 2024:
„Die fehlende richterliche Prüfung bei Löschentscheidungen führt zu einem massiven Machtungleichgewicht zwischen Bürger und Plattform.“
4. Reporter ohne Grenzen – Stellungnahme 2024:
„Der DSA in Kombination mit nationalen Strafnormen erzeugt eine Atmosphäre struktureller Einschüchterung.“
5. Allensbach-Institut – Meinungsfreiheitserhebung 2024:
63 % der Deutschen sagen: „Ich sage meine Meinung nur noch im privaten Kreis.“
72 % empfinden staatliche Regeln zur Äußerung als „einschüchternd“
47 % sehen Social Media als „unsicherer Ort für Meinungsäußerung“
2.1.8 – Fazit: Die stille Gleichschaltung
Was früher offen Zensur hieß, heißt heute: „gemeinschaftswidriger Inhalt“, „plattformsensible Aussage“, „mangelnde Konformität mit DSA“.
Doch das Ergebnis ist dasselbe: Die freie, kontroverse, mutige Debatte wird verdrängt durch autorisierte Narrative.
Das ist keine Verschwörungstheorie.
Das ist dokumentierte Realität, gestützt durch:
-
EU-Gesetzeslagen
-
Plattformmechanismen
-
Juristische Kritik
-
Reale Fallbeispiele
-
Statistische Entwicklungen
„Zensur beginnt nicht mit der Entfernung eines Beitrags. Sie beginnt mit dem Gedanken, ihn besser gar nicht erst zu schreiben.“ – Alexander Erber
Wer Unternehmer, Investor oder Führungskraft ist, sollte diese Entwicklung nicht ignorieren, sondern verstehen – und daraus Konsequenzen ableiten.
Denn was heute gelöscht wird, kann morgen bereits zu Konto-Sperrung, Kreditentzug, Verlust von Sichtbarkeit oder rechtlicher Verfolgung führen.
Digitale Unsichtbarkeit: Wie Plattformen Meinungen löschen, ohne zu löschen
„In der digitalen Welt muss man Inhalte nicht mehr löschen, um sie verschwinden zu lassen. Es reicht, sie nicht mehr zu zeigen.“ – Alexander Erber
2.2.1 – Das Ende der Sichtbarkeit beginnt im Algorithmus
Die Zeiten, in denen Zensur durch Streichung oder Sperrung stattfand, sind vorbei.
Im Jahr 2025 bedeutet Zensur: Unsichtbarkeit.
Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn, X und YouTube setzen hochentwickelte Ranking-Algorithmen ein, um Inhalte zu priorisieren – oder zu entwerten.
Was nicht mehr im Feed erscheint, existiert faktisch nicht mehr. Es gibt keine Benachrichtigung, keinen Hinweis. Nur Stille.
Diese neue Form der digitalen Manipulation hat einen Namen:
Shadowbanning.
2.2.2 – Was ist Shadowbanning – und wie funktioniert es wirklich?
Definition:
Shadowbanning ist eine Plattformmaßnahme, bei der Inhalte gezielt unterdrückt oder für andere Nutzer unsichtbar gemacht werden – ohne dass der Verfasser davon erfährt.
Formen von Shadowbanning:
-
Der Beitrag erscheint nicht mehr im Newsfeed anderer Nutzer
-
Kommentare werden nur dem Autor angezeigt, aber sonst niemandem
-
Der Account wird algorithmisch herabgestuft („Visibility Penalty“)
-
Inhalte sind nicht mehr auffindbar über Hashtags oder Suche
-
Keine Benachrichtigungen bei Interaktionen
Wichtig:
Shadowbanning ist nicht öffentlich dokumentiert, sondern Teil interner Moderationsprozesse.
Plattformen wie Meta, TikTok oder YouTube bestätigen es nur in technischen Fachpapieren, nie in der offiziellen Nutzerkommunikation.
2.2.3 – Strategien der Plattformen: Konformität durch Code
Warum greifen Plattformen zu Shadowbanning statt offener Löschung?
-
Weniger Widerstand:
Der Nutzer bemerkt es nicht. Kein Protest. Kein Skandal. Kein Screenshot. -
Rechtsvermeidung:
Keine offizielle Löschung = kein rechtlicher Einspruch möglich -
Kompatibilität mit EU-Recht:
Plattformen können regulatorischen Anforderungen genügen, ohne sichtbare Repression -
Image-Pflege:
Offene Sperren führen zu Presse. Schattenlöschungen nicht.
„Die Plattformen steuern, was gedacht wird – nicht durch Zensur, sondern durch Reichweite.“
– Ex-Google-Policy-Analystin Anna Lenhart (US-Kongressanhörung, 2023)
2.2.4 – Fallbeispiele: Shadowbanning im Alltag
Fall 1: Unternehmer auf LinkedIn
Ein Geschäftsführer postet einen kritischen Beitrag über die wirtschaftliche Lage in Deutschland – nüchtern, faktenbasiert, ohne beleidigende Sprache.
-
Normal: 120 Likes, 25 Kommentare, 8.000 Reichweite
-
Aktueller Post: 3 Likes, 0 Kommentare, 250 Reichweite
-
Kommentar eines Follower: „Ich sehe deinen Post nicht mehr im Feed.“
Analyse:
Algorithmische Downrank-Maßnahme wegen Triggerworten wie „Regulierungswahnsinn“, „Steuerlast“, „Systemproblem“.
Fall 2: Instagram-Influencerin
Thema: Kritik an Genderpolitik in Schulen
Innerhalb von 24 Stunden – Reichweitenverlust um 80 %
Keine Löschung, aber Story-Views stürzen ab
Kommentare deaktiviert, Posts nicht mehr auffindbar über Hashtags
Fall 3: YouTube-Kanal
Ein Kanal mit 230.000 Abonnenten postet ein Video über „Demokratische Alternativen in Europa“.
Innerhalb von 2 Tagen:
-
Video wird „entmonetarisiert“
-
Kein Vorschlag in Empfehlungen
-
Sichtbarkeit über Suchfunktion gesperrt
-
Kommentarbereich deaktiviert
2.2.5 – Belege & Analysen: Studien zu Sichtbarkeitsreduktion
1. Harvard Kennedy School – Studie „The Invisible Post“ (2023):
Plattformen wenden gezielte Sichtbarkeitsmanipulationen auf politische Inhalte an – ohne Kennzeichnung.
Besonders betroffen: Beiträge mit EU-kritischem, migrationskritischem oder regierungskritischem Inhalt.
2. AlgorithmWatch & Netzpolitik.org (2024):
Instagram reduziert systematisch die Reichweite von Beiträgen mit Wörtern wie „Kritik“, „NetzDG“, „WHO“, „Verfassung“.
3. NYU Stern Center (2023):
67 % der untersuchten Shadowbanning-Fälle betrafen konservative, wirtschaftsliberale oder migrationskritische Inhalte.
4. Facebook Leaks (2022):
Interne Richtlinien: Inhalte mit „potenzial disruptivem politischen Inhalt“ werden algorithmisch herabgestuft – automatisiert, ohne menschliche Prüfung.
2.2.6 – Juristische Grauzone: Kein Einspruch möglich
Shadowbanning bewegt sich in einer perfekten Grauzone zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Wirkung.
Denn: Es gibt keine Löschung, also auch keinen formellen Verwaltungsakt.
Und damit auch keinen:
-
Widerspruch
-
Beschwerdeweg
-
Rechtsschutz
Selbst wenn Nutzer bemerken, dass ihre Beiträge „unsichtbar“ sind, haben sie keine Handhabe.
Die Plattformen berufen sich auf ihre AGB und Nutzungsbedingungen, die sie einseitig anpassen können.
„Der Nutzer zahlt nichts. Der Nutzer hat kein Recht.“
– Auszug aus Facebooks AGB, Abschnitt Datenverfügbarkeit
Fazit: Die digitale Öffentlichkeit unterliegt keiner demokratischen Kontrolle mehr.
Statt einem Gericht entscheidet ein Ranking-Algorithmus, der nicht einmal öffentlich dokumentiert ist.
2.2.7 – Psychologische Wirkung: Die stille Umerziehung
Die perfideste Folge dieser Plattformtaktiken ist nicht die Unsichtbarkeit an sich – sondern die Selbstzensur, die daraus resultiert.
Viele Unternehmer, Berater, Coaches, Autoren und Freidenker erleben wiederholt:
-
Plötzlichen Reichweitenverlust
-
Ausbleibende Reaktionen auf früher erfolgreiche Inhalte
-
Verstummen ihrer digitalen Stimme
Was folgt?
-
Sie beginnen, ihre Wortwahl anzupassen
-
Sie vermeiden bestimmte Themen
-
Sie überprüfen Beiträge mehrfach – aus Angst vor „Negativ-Ranking“
„Shadowbanning wirkt wie eine unsichtbare Hand, die dir sagt: Schreib lieber nichts, was anecken könnte.“ – Zitat eines No Borders Founder Klienten, 2024
Diese subtile Disziplinierung hat eine ähnliche Wirkung wie klassische Zensur – mit einem Unterschied:
Sie braucht keine Polizei. Keine Urteile. Keine Gefängnisse.
Nur einen Algorithmus, eine Richtlinie – und deine Angst, nicht mehr sichtbar zu sein.
2.2.8 – Fazit: Wer steuert die Sichtbarkeit, steuert die Meinung
In Kapitel 2 haben wir gesehen, wie die juristische Regulierung (DSA, EMFA, NetzDG)
und die technologische Kontrolle (Shadowbanning, Downranking, Filter)
zusammenwirken, um eine neue Realität zu schaffen:
Du darfst sagen, was du willst – aber niemand wird es mehr hören.
Der Diskurs wird nicht mehr durch Argumente gewonnen, sondern durch Algorithmuszugang.
Und dieser Zugang ist kein Recht, sondern ein Privileg – vergeben durch Plattformen, auf Basis unkontrollierter Regeln, gestützt von EU-Richtlinien.
Für Unternehmer, Investoren und öffentliche Persönlichkeiten hat das direkte Folgen:
-
Sichtbarkeit = Währung
-
Meinung = Risiko
-
Positionierung = rechtlich-politisches Minenfeld
Strafrechtlich verfolgt – Wie Meinungen zum Haftungsrisiko werden
„Was man nicht mehr kritisieren darf, ist keine Demokratie mehr, sondern ein Glaubenssystem.“ – Alexander Erber
3.1 – Wenn das Strafrecht politisch wird
Das Strafrecht eines Rechtsstaats soll Verbrechen ahnden – nicht Meinung disziplinieren. Doch genau diese Grenzverschiebung beobachten wir heute: in Social Media, im öffentlichen Raum, in Unternehmen.
Wo einst das Grundgesetz als Schutzschild galt, wird es zunehmend umgangen durch ein juristisches Arsenal, das längst nicht mehr neutral wirkt. Unternehmer, Investoren, Coaches oder kritische Bürger erleben, wie eine abweichende Meinung zum Risiko wird – nicht nur gesellschaftlich, sondern strafrechtlich.
Die Entwicklung lässt sich an drei zentralen Paragraphen festmachen:
-
§188 StGB – Schutz von Politikern vor Kritik
-
§130 StGB – Ausweitung des Volksverhetzungsbegriffs
-
§126a StGB – Neue Repression bei „Delegitimierung des Staates“
Doch es geht nicht nur um Gesetze. Es geht um ihre Auslegung, ihre Anwendung – und darum, wer sie wann, warum und gegen wen zum Einsatz bringt.
3.2 – §188 StGB: Kritik an Politikern wird strafbar
Der §188 StGB schützt „Personen des politischen Lebens“ vor herabwürdigender Kritik. Ursprünglich gedacht für Verleumdungskampagnen, wird er heute zur Waffe gegen Online-Diskurs.
Fallbeispiel 1:
Ein selbstständiger Unternehmer aus Niedersachsen äußert sich auf X (ehemals Twitter) zu Karl Lauterbachs Aussagen zur Pandemiepolitik. Seine Formulierung:
„Dieser Mann ist entweder ein Fanatiker oder völlig überfordert.“
Zwei Wochen später:
-
Vorladung zur Polizei
-
Anzeige wegen Beleidigung nach §188
-
Hausdurchsuchung unter dem Vorwand, „digitale Beweise“ sichern zu müssen
Die Verfahren werden oft eingestellt – doch der Schaden ist längst entstanden:
-
Klientendaten beschlagnahmt
-
Geschäftspartner verunsichert
-
Ruf beschädigt
-
Emotionale Belastung für Familie und Team
„Die eigentliche Strafe ist nicht das Urteil. Die eigentliche Strafe ist das Verfahren selbst.“
– Alexander Erber
3.3 – §130 StGB: Der Gummiparagraph
§130 StGB, der „Volksverhetzungsparagraph“, wurde ursprünglich geschaffen, um Holocaustleugnung zu bestrafen. Inzwischen ist er so ausgeweitet worden, dass auch sachliche Kritik an Regierungspolitik, insbesondere im Kontext von Migration oder Sicherheit, unter Generalverdacht gestellt werden kann.
Fallbeispiel 2:
Ein Finanzberater postet einen Kommentar auf Facebook:
„Die aktuelle Einwanderungspolitik überfordert unsere sozialen Systeme – das ist politischer Irrsinn.“
Ein Screenshot wird anonym an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Ergebnis:
-
Anzeige wegen „Volksverhetzung“
-
Ermittlungsverfahren
-
Pressebericht in der Lokalzeitung über das Verfahren
-
Kündigung durch einen Großkunden mit dem Hinweis: „Wir wollen keine politische Kontroverse.“
Das Verfahren endet ergebnislos – aber der wirtschaftliche Schaden bleibt irreversibel.
Juristenkritik:
„Der Paragraph wird inzwischen oft zur Bekämpfung unerwünschter Meinungen benutzt, nicht zum Schutz gefährdeter Gruppen.“ – Dr. Ulrich Vosgerau, Verfassungsjurist, 2024
3.4 – §126a StGB: Die neue Waffe gegen Systemkritik
Der §126a wurde im Jahr 2022 eingeführt und ist das, was Kritiker einen „politischen Gefährdungsparagraphen“ nennen. Er erlaubt die strafrechtliche Verfolgung von Aussagen, die geeignet sind, das Vertrauen in die staatliche Ordnung zu untergraben.
Beispiele für Anwendungsfälle:
-
Kritik an Maßnahmen während der Pandemie
-
Aussagen über Korruption in Behörden
-
Kritik an Verflechtungen zwischen Medien und Politik
Fallbeispiel 3:
Ein Immobilienunternehmer äußert auf seinem Firmenblog:
„Es ist besorgniserregend, wie weit der Staat inzwischen in unser Leben eingreift.“
Er wird angezeigt – nicht von einer Person, sondern durch ein automatisiertes Meldesystem der Landesmedienanstalt. Ergebnis:
-
Vorladung wegen Anfangsverdacht auf Delegitimierung
-
Gespräche mit der Hausbank über „Imageprobleme“
-
Verlust der Finanzierung eines Großprojekts
3.5 – Hausdurchsuchung wegen eines Emojis
Der absurde Tiefpunkt ist erreicht, wenn selbst Emojis als strafrechtlich relevant eingestuft werden.
Fallbeispiel 4:
Ein Klient von No Borders Founder klickt auf X auf ein Herz-Emoji unter einem Beitrag, der sich kritisch mit der Kriegsrhetorik deutscher Politiker auseinandersetzt. Zwei Wochen später steht ein Durchsuchungsbeschluss im Raum – Begründung: „Billigung potenziell staatsfeindlicher Inhalte“.
Auch wenn das Verfahren eingestellt wird: Der Eintrag in polizeiliche Datenbanken bleibt bestehen. Und in vielen Branchen reicht das, um ein KfW-Darlehen oder eine Projektbeteiligung nicht zu bekommen.
3.6 – Anzeigen durch Aktivisten, NGOs, Parteien
Immer häufiger werden Strafanzeigen nicht durch betroffene Bürger gestellt, sondern durch Organisationen, politische Aktivisten oder sogenannte „Watchdog“-Gruppen. Besonders aktiv:
-
Correctiv & angeschlossene Meldegruppen
-
Parteien (Grüne, SPD – offizielle Beschwerdestrukturen)
-
Anti-Hass-Organisationen mit automatisierten Scanprogrammen
Diese Gruppen scannen systematisch Beiträge auf sozialen Netzwerken, speichern IP-Adressen, melden Inhalte gebündelt an Polizei oder Landeszentralen.
Ergebnis:
Eine kritische Aussage wird nicht mehr durch Debatte beantwortet, sondern durch juristische Einschüchterung erstickt.
3.7 – Warum Unternehmer besonders gefährdet sind
Unternehmer, Coaches, Berater, Autoren, Speaker – sie stehen öffentlich. Sie haben Namen, Marken, Webseiten, Auftritte.
Was bei anonymen Accounts verpufft, wird bei ihnen zur relevanten Angriffsfläche. Besonders gefährdet sind:
-
Unternehmer mit politischer Meinung
-
Coaches mit gesellschaftlicher Haltung
-
Investoren mit öffentlich-rechtlicher oder medialer Reichweite
-
Redner mit Social-Media-Präsenz
Was droht?
-
Reputationsverlust durch gezielte Medienberichte („Unternehmer unter Verdacht…“)
-
Kundenverlust durch Compliance-Druck
-
Einträge in Polizeidatenbanken (auch bei Verfahrenseinstellung)
-
Problematische Bonitätsverschlechterung bei Finanzierung, Leasing, Projekten
-
Kontenschließungen durch Banken wegen „Risikoimage“
3.8 – Juristisch wehrlos? Nein – aber ausgeliefert
Die betroffenen Personen können sich verteidigen. Doch das bedeutet:
-
Sofortiger Gang zum Strafverteidiger
-
Öffentlichkeitskrise managen
-
Daten forensisch sichern
-
Aussagen strategisch vorbereiten
-
Kosten in Höhe von 5.000–15.000 EUR im Erstverfahren
Viele Unternehmer erleben diese Situationen als Ohnmacht – und beginnen, ihre Kommunikation anzupassen.
Die Folge: Selbstzensur, Rückzug, Angst.
3.9 – Fazit: Wenn das Recht zum Werkzeug wird
Der Rechtsstaat basiert auf Vertrauen. Doch dieses Vertrauen wird beschädigt, wenn Gesetze nicht mehr zum Schutz, sondern zur Disziplinierung eingesetzt werden.
Was wir im Kapitel besprochen haben:
-
Strafanzeigen werden immer häufiger politisch motiviert gestellt
-
Gesetzesparagraphen wie §188, §130 und §126a werden weit ausgelegt
-
Unternehmer und Coaches werden gezielt eingeschüchtert
-
Selbst bei Verfahrenseinstellung bleibt wirtschaftlicher Schaden
-
Die Meinungsfreiheit ist nicht mehr faktisch geschützt
Vom Strafrecht zum Reputationsvernichter
Im nächsten Kapitel zeigen wir:
-
Wie öffentliche Anklagen zur wirtschaftlichen Zerstörung führen
-
Warum „Cancel Culture“ nicht nur moralisch, sondern wirtschaftlich vernichtet
-
Wie Reputationsrisiken heute systematisch eingesetzt werden
-
Was es heißt, „sozial vernichtet“ zu werden – ohne Gerichtsurteil
„Früher verlor man durch Prozesse. Heute reicht ein Shitstorm mit einem Hashtag.“
– Alexander Erber
Cancel Culture 2.0 – Der soziale Tod durch Rufmord, Boykott und Plattformvernichtung
„Es braucht heute keinen Gerichtsbeschluss mehr, um einen Unternehmer zu vernichten. Eine gezielte Kampagne reicht.“ – Alexander Erber
4.1 – Die Mechanik der modernen Rufvernichtung
Cancel Culture ist kein spontaner Empörungsreflex mehr. Es ist ein hochorganisiertes System zur Kontrolle öffentlicher Meinung und ökonomischer Ausschlüsse. Während früher Kritik geäußert, diskutiert oder widerlegt wurde, erleben wir heute: Wer widerspricht, wird gelöscht – aus Plattformen, Netzwerken und wirtschaftlichen Strukturen.
Die Mechanik funktioniert in drei Phasen:
-
Digitales Auffinden (Monitoring):
KI-gestützte Tools, Watchdog-Gruppen, Aktivisten durchsuchen Social-Media-Plattformen, Podcasts, Blogs, Businessseiten und Interviews nach Aussagen, die als „kritisch“ oder „abweichend“ gelten. -
Anprangern (Framing):
Einzelne Aussagen werden isoliert, kontextlos herausgestellt, emotional aufgeladen und öffentlich zur Schau gestellt – bevorzugt mit Begriffen wie „menschenverachtend“, „rechtsoffen“ oder „Verschwörung“. -
Deplattforming & Boykott (Strafaktion):
Plattformkonten werden gesperrt, Bankverbindungen gekündigt, Aufträge storniert, Kooperationspartner distanzieren sich, Medien greifen das Thema auf – und erzeugen so eine Lawine, die wirtschaftlich vernichtend ist.
4.2 – Medienkampagnen & Shitstorms als Disziplinierung
Die Entstehung eines Shitstorms ist heute kein Zufall, sondern häufig gezielt gesteuert. NGOs, Medienaktivisten, Lobbyorganisationen und politische Gruppen verfügen über eigene Reichweiten und Verteiler. Einzelne Begriffe wie „Klimaleugner“, „Impfgegner“, „Populist“, „rückständig“, „rechts“ reichen aus, um eine mediale Eskalation zu provozieren.
Fallbeispiel 1: Unternehmensberater (2022)
Ein erfolgreicher Speaker und Coach äußerte sich in einem LinkedIn-Post kritisch über das politische Bildungswesen. Keine Beleidigungen, kein Hass – nur Analyse und Kritik. Innerhalb von 24 Stunden:
-
Shitstorm mit über 1.200 negativen Kommentaren
-
Artikel in einem Regionalmedium: „Coach mit Nähe zu Verschwörungsnarrativen?“
-
Kündigung eines Großkunden mit sechsstelliger Beauftragung
-
XING und LinkedIn schränkten seine Sichtbarkeit massiv ein
Das Statement: korrekt, differenziert, analytisch. Die Wirkung: wirtschaftliche Zerstörung.
4.3 – Wenn Like, Retweet oder Kommentar reicht
Besonders perfide: Es genügt heute nicht mehr, etwas selbst zu sagen. Es reicht, etwas zu liken, zu teilen oder zu kommentieren, das als politisch inkorrekt gilt.
Fallbeispiel 2: Steuerberaterin (2023)
Sie setzte ein Like unter ein YouTube-Interview mit einem migrationskritischen Journalisten.
Ergebnis:
-
Ein Screenshot wurde an ihre Kammer weitergeleitet
-
Ein Verfahren wegen „standeswidrigem Verhalten“ wurde eingeleitet
-
In mehreren Bewertungsportalen tauchten plötzlich 1-Sterne-Bewertungen mit diffamierenden Inhalten auf
-
Zwei Mandanten kündigten „aus Imagegründen“
Was öffentlich nicht verfolgt wird, wird durch berufliche Vernichtung ersetzt.
4.4 – Plattformsperren & Deplatforming
Plattformen wie X, LinkedIn, YouTube, Instagram, Patreon oder sogar PayPal haben sich in den letzten Jahren zu Gatekeepern der Sichtbarkeit und Zahlungsfähigkeit entwickelt. Wer nicht konform ist, fliegt.
Beispiele:
-
Jordan Peterson (Kanada) – Plattformlöschungen nach Aussagen zur Genderpolitik
-
Daniele Ganser (Schweiz) – Sichtbarkeit auf YouTube und Eventplattformen massiv eingeschränkt
-
Mehrere Journalisten und Mediziner in Deutschland – YouTube-Kanäle gelöscht wegen „medizinischer Desinformation“, obwohl Inhalte korrekt waren
Das Muster:
Keine öffentliche Verurteilung. Kein Rechtsweg. Nur ein interner Verstoß gegen „Community Guidelines“.
4.5 – Wirtschaftlicher Ausschluss durch Dienstleister
Wer seine Meinung äußert, verliert nicht nur Likes – er verliert Konten, Tools, Zahlungsabwicklung, Buchhaltung.
Reale Folgen:
-
Kündigung von Konten bei PayPal, Stripe, Klarna, Wise
-
Zahlungsanbieter wie Mollie verweigern Integration bei „problematischen Meinungsführern“
-
Hosting-Plattformen wie GoDaddy oder Squarespace beenden Verträge bei „verstoßenden Inhalten“
-
CRM-Systeme und Newsletteranbieter wie Mailchimp oder GetResponse sperren Accounts
„Wenn du plötzlich keine Rechnung mehr stellen kannst, ist deine Meinung nichts mehr wert.“
– Zitat eines Klienten von No Borders Founder
4.6 – Reputationsmanagement durch Drittanbieter
Es gibt heute eine ganze Industrie, die sich darauf spezialisiert hat, Reputationen zu bewerten – oft im Interesse von Medien, Plattformen und politischen Institutionen.
Beispiele:
-
NewsGuard bewertet Medienseiten und Autoren – bei „Fehlinformation“ gibt es rote Labels
-
Bot Sentinel erstellt Negativ-Rankings zu X-Nutzern mit „toxischem Einfluss“
-
Correctiv arbeitet mit öffentlich-rechtlichen Medien zur „Faktenprüfung“ – aber wer prüft Correctiv?
-
Reset.Tech (finanziert durch Open Society) beeinflusst Suchmaschinenrankings
Diese Instanzen sind nicht demokratisch legitimiert, agieren aber mit massiver Reichweite und bestimmen, wer „vertrauenswürdig“ ist – oder eben nicht.
4.7 – Die Rolle von NGOs, Aktivisten & politischen Netzwerken
Hinter vielen dieser Aktionen stehen netzwerkartige Strukturen, die von Stiftungen, Parteien oder politischen Bewegungen finanziert werden. Deren Ziel: Agenda-Setting durch Meinungsmacht.
Typische Akteure:
-
Stiftungen (Heinrich-Böll, Open Society, Amadeu Antonio etc.)
-
Aktivistengruppen mit direkter Medienanbindung
-
Plattform-interne Trust & Safety Councils mit politischem Einfluss
Diese Gruppen entscheiden oft mit, welche Accounts gelöscht werden, welche Inhalte „toxisch“ sind, und welche Personen „problematisch“ seien.
Was fehlt:
Transparenz. Rechtsschutz. Fairness.
Was bleibt: Angst, Vorsicht, Rückzug.
4.8 – Psychologische Zerstörung: Angst, Isolation, Rückzug
Ein Unternehmer, der sich öffentlich äußert, riskiert heute nicht nur wirtschaftliche Folgen – sondern auch Isolation, Panik und psychische Belastung.
-
Angst, der Familie zu schaden
-
Angst, den Lebensunterhalt zu verlieren
-
Schuldgefühle gegenüber Mitarbeitern
-
Kontrollverlust, Ohnmacht, Überwachung
Viele ehemalige Speaker, Autoren und Experten ziehen sich vollständig zurück.
Sie stellen keine Inhalte mehr online, löschen ihre Social-Media-Kanäle, beenden ihre Podcast-Reihen – nicht aus Desinteresse, sondern aus Angst vor Zerstörung.
Cancel Culture ist kein Trendbegriff. Es ist heute eine wirtschaftliche Vernichtungswaffe.
Sie braucht:
-
keinen Richter
-
keinen Beweis
-
keinen Gerichtssaal
Sie braucht nur:
-
einen Screenshot
-
eine koordinierte Empörung
-
und die richtigen Plattformverbindungen
Das nächste Kapitel zeigt die nächste Stufe:
Wie Reputationssysteme, ESG-Ratings, digitale Vertrauenspunkte und automatisierte Bewertungsalgorithmen den „sozialen Score“ eines Menschen steuern – und wie Unternehmer in eine neue Form von kreditwürdiger Konformität gedrängt werden.
ESG, Reputationsscores und digitale Ratings – Wie Konformität zur Geschäftsgrundlage wird
„In Zukunft zählt nicht, was Sie leisten – sondern ob Sie mit dem System kompatibel sind.“
– Alexander Erber
5.1 – Vom digitalen Shitstorm zur digitalen Insolvenz
Was im letzten Kapitel mit moralischer Ausgrenzung begann, erreicht nun eine neue Stufe: die systematische wirtschaftliche Kontrolle. Cancel Culture war das Vorspiel – jetzt folgt der ökonomische Hebel: ESG-Vorgaben, Reputationsbewertungen, algorithmische Scoring-Systeme und die Plattformökonomie, die Konformität zur Geschäftsgrundlage erhebt.
Die Wahrheit ist unbequem:
Viele Unternehmer verlieren heute nicht wegen schlechter Leistung, sondern wegen falscher Signale ihren Platz im Markt.
„Sie dürfen wirtschaften – aber nur, wenn Sie das Richtige vertreten.“
5.2 – ESG: Umwelt, Soziales, Governance – oder politisches Dogma?
ESG steht für „Environmental, Social and Governance“ – drei Säulen, die ursprünglich für Nachhaltigkeit und Ethik im Geschäftsleben stehen sollten. Doch in der Praxis wird ESG zunehmend als Zwangssystem eingesetzt, das wirtschaftliche Aktivität von ideologischer Anpassung abhängig macht.
ESG in der Praxis:
-
Environmental: CO₂-Bilanzen, Umweltzertifikate
-
Social: Diversity, Gleichstellung, Inklusion
-
Governance: Antikorruption, ethische Lieferketten
Wer in diesen Kategorien „negativ“ bewertet wird, verliert heute:
-
Zugang zu Bankkrediten
-
Investoreninteresse
-
Marktzulassung in ESG-orientierten Fonds
-
Partnerschaften mit Konzernen
-
Chancen bei Ausschreibungen
Ein interner Compliance-Bericht einer DAX-Bank (2024, anonymisiert) formuliert es nüchtern:
„ESG ist kein Vorschlag – es ist die neue Geschäftsgrundlage.“
5.3 – Reputationsscores: Die Bewertung Ihrer wirtschaftlichen Existenz
Reputationsbewertung war früher Imagepflege – heute ist sie Teil Ihrer Bonität. Immer mehr Banken, Zahlungsdienstleister und Plattformen nutzen sogenannte Reputation Scores, um über Geschäftsbeziehungen zu entscheiden.
Die neue Wirklichkeit:
| Anbieter | Kriterium | Konsequenz bei negativem Score |
|---|---|---|
| NewsGuard | Bewertung journalistischer Quellen | Sichtbarkeit in Newsfeeds wird reduziert |
| World-Check | PEP, politische Nähe, Kontroversen | Bankverbindungen verweigert oder gekündigt |
| Riskified / Kount | Verhaltensanalyse im Zahlungsverkehr | Transaktionen werden blockiert oder rückabgewickelt |
| Reset.Tech | Einfluss auf Suchmaschinen-Ranking | Sichtbarkeit in Suchergebnissen sinkt massiv |
Diese Scores entstehen ohne Ihre Mitwirkung, ohne Ihr Wissen und ohne echte Widerspruchsmöglichkeit.
5.4 – Der digitale Vertrauenswert – KI entscheidet über Ihre Kreditwürdigkeit
Moderne Finanzsysteme nutzen Künstliche Intelligenz nicht nur zur Analyse Ihrer Zahlen – sondern auch zur Bewertung Ihrer Person. Dabei spielen folgende Punkte eine Rolle:
-
Historische Online-Aktivitäten
-
Beiträge in sozialen Netzwerken
-
Medienberichte über Ihr Unternehmen
-
Verbindungen zu kritischen Personen oder Themen
-
Plattformverhalten (z. B. Content-Typen, Likes, Follower)
Ergebnis:
Ein einziger Fehltritt – oder gar ein veralteter Post – kann dazu führen, dass:
-
Ihre Kreditlinie eingeschränkt wird
-
Sie keine neuen Geschäftskonten eröffnen können
-
Ihr digitales Profil als „nicht vertrauenswürdig“ markiert wird
-
Ihre Bonität automatisch herabgestuft wird
„Sie verlieren Ihre wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, ohne zu wissen, warum.“
– Exklusives Zitat eines Bank-Insiders in Dubai (2025)
5.5 – Banken, Zahlungsdienste & Plattformen als neue Geschäftsrichter
In der Vergangenheit war Ihre Bonität entscheidend. Heute ist es Ihre ideologische Konformität.
Banken, FinTechs und Zahlungsdienstleister agieren mittlerweile als verlängerte Compliance-Arme politischer und aktivistischer Institutionen.
Beispiele:
-
Kontosperrung nach ESG-kritischen Aussagen
-
Rückstufung im Geschäfts-Rating nach medialem Shitstorm
-
Auslistung von Verkaufsplattformen nach politischem Kommentar
-
Kündigung von Zahlungsdienstverträgen ohne Angabe von Gründen
„Sie sind wirtschaftlich gelöscht – nicht weil Sie insolvent sind, sondern weil Sie unbequem sind.“
5.6 – Drei Fallstudien realer Rufvernichtung durch Ratings
Fall 1 – IT-Consultant aus der Schweiz
-
LinkedIn-Post zur Bürokratie im ESG-Reporting
-
Plattform-Visibility reduziert
-
Venture-Finanzierung wird storniert
-
NewsGuard senkt Score der Website
-
Bank lehnt geplanten Kredit ab
Folge: Projekt scheitert, Team wird entlassen, Firma liquidiert
Fall 2 – Unternehmerin (Immobilien, Deutschland)
-
Repost eines Artikels zur Migrationskriminalität
-
Screenshots verbreiten sich in Aktivisten-Kreisen
-
Immobilienplattform entfernt Exposés
-
Hausbank kündigt Finanzierung
-
Partneragenturen beenden Zusammenarbeit
Folge: Ruf zerstört, Geschäft eingefroren, Rückzug aus der Branche
Fall 3 – Start-up Wien
-
CEO äußert sich im Podcast kritisch über Diversity-Vorgaben
-
Pressebericht mit Framing „rechtsoffenes Startup?“
-
Kooperationspartner steigen aus
-
ESG-Rating wird herabgestuft
-
Förderstelle entzieht Zusage
Folge: Kein Launch, strategisches Aus
5.7 – Das neue Normal: Reputationsökonomie statt Marktwirtschaft
Die freie Marktwirtschaft stirbt nicht an ökonomischer Ineffizienz – sondern an ideologischer Kontrolle.
Was heute zählt:
-
Ihre Haltung
-
Ihre digitalen Spuren
-
Ihre Nähe zu „sensiblen Themen“
-
Ihre mediale Kompatibilität
Wenn Sie davon abweichen, verlieren Sie Stück für Stück Ihren Zugang zu Märkten, Kapital, Plattformen und Netzwerken – und das ohne offizielle Kommunikation, ohne Vorwarnung, ohne Chance auf Wiederherstellung.
5.8 – Strategien zum Schutz: So bleiben Sie unabhängig
No Borders Founder bietet hochstrukturierte, internationale Schutzstrategien, die Ihnen erlauben, unabhängig von ESG-Vorgaben und Ratings wirtschaftlich aktiv zu bleiben:
| Maßnahme | Wirkung |
|---|---|
| Firmensitz außerhalb des ESG-Raums | Kein Zugriff durch EU-Regelwerke und Plattformkonformität |
| Private Banking außerhalb Europas | Ausschluss von automatisierten Risikoscorings |
| Holding- & Trust-Modelle | Schutz durch Strukturtrennung |
| Citizenship by Investment | Jurisdiktion wechseln, Zugriff auf freie Staaten (VAE, Karibik etc.) |
| Plattformstrategie & Sichtbarkeit | Dezentralisierung, alternative Kanäle, Reputationstrennung |
„Freiheit ist keine Ideologie. Sie ist eine Strukturfrage.“ – Alexander Erber
CBDCs – Der letzte Schritt zur totalen Kontrolle
Wenn ESG die neue Richtlinie ist, Reputationsscores die Filter sind und Plattformen als Richter auftreten – dann fehlt nur noch eines:
Die vollständige Kontrolle über Ihr Geld.
Das nächste Kapitel wird sich genau dieser Realität widmen:
-
Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs)
-
Echtzeitüberwachung Ihrer Ausgaben
-
Automatisierte Sanktionen bei Regelabweichung
-
Bargeldverbot & Zahlungskonditionierung
-
Der finale Kontrollmechanismus über Ihre gesamte wirtschaftliche Existenz
Digitale Zentralbankwährungen (CBDCs): Die letzte Stufe der Kontrolle über Geld, Bürger und Freiheit
6.1 – Was sind CBDCs – und was unterscheidet sie vom heutigen Geld?
CBDC steht für Central Bank Digital Currency – also eine digitale Währung, die direkt von einer Zentralbank emittiert und verwaltet wird.
Im Gegensatz zu Bitcoin oder Stablecoins handelt es sich nicht um ein dezentrales, privates Zahlungsmittel, sondern um ein staatliches, programmierbares Instrument mit vollständiger Rückverfolgbarkeit.
Unterschiede zum heutigen System:
| Kriterium | Bargeld | Giralgeld (Bankkonto) | CBDC |
|---|---|---|---|
| Herausgeber | Zentralbank | Geschäftsbank | Zentralbank |
| Rückverfolgbarkeit | Nein | Eingeschränkt | Vollständig & in Echtzeit |
| Programmierbarkeit | Nein | Gering | Hoch (z. B. Ablaufdaten, Zweck) |
| Offline-Nutzung möglich | Ja | Nein | Teilweise (mit Einschränkungen) |
| Anonymität | Hoch | Mittel | Keine |
CBDCs sind nicht bloß digitalisierte Euros oder Dollar – sie sind ein neues geldpolitisches Paradigma, das technische Kontrolle mit staatlicher Steuerung vereint.
6.2 – Der Fahrplan der EZB: Der digitale Euro kommt
Die Europäische Zentralbank plant die Einführung des digitalen Euro im dritten Quartal 2025.
Offiziell noch in der „Vorbereitungsphase“, aber faktisch technisch abgeschlossen, wurden bereits Pilotprojekte mit Großbanken, Händlern und Regierungen durchgeführt.
Laut EZB (März 2025):
„Der digitale Euro wird das Bargeld nicht ersetzen, sondern ergänzen – aber er wird Voraussetzungen für modernes Bezahlen in einer digitalen Wirtschaft schaffen.“
Doch zwischen den Zeilen liest man klar: Es geht um Transparenz, Nachverfolgbarkeit, Compliance, Anti-Terror & Anti-Steuerhinterziehung – mit anderen Worten: Totale Kontrolle über den Geldfluss.
Geplante Eckpunkte:
-
Private Wallets bei Zentralbank oder Intermediären
-
Nutzung via Smartphone, Karte oder QR
-
Transaktionslimits zur Wahrung der „Privatsphäre“ (z. B. 1.000 € pro Woche anonym)
-
Verpflichtende Identifizierung ab bestimmter Transaktionshöhe
-
Programmierung von Zahlungsbedingungen möglich (z. B. nur für bestimmte Waren verwendbar)
6.3 – Die globale Landschaft: Wer führt CBDCs ein – und wer nicht?
Ein Überblick über die internationalen Entwicklungen:
| Land / Region | Status 2025 | Besonderheiten / Strategie |
|---|---|---|
| China | Aktiv im Einsatz | Digitaler Yuan mit QR & Gesichtserkennung, stark kontrolliert |
| Indien | Ausgerollt | Wallets mit KYC-Pflicht, starke Bindung an ID-System |
| Nigeria | Bereits eingeführt (eNaira) | Bevölkerung boykottiert → Bargeldlimitierungen zur „Erziehung“ |
| USA | Abgelehnt (2025) | Federal Reserve & Regierung: „CBDCs bergen Überwachungsrisiken“ |
| UK | Pilotphase abgeschlossen | Einführung nicht vor 2026 |
| Schweiz | Skeptisch, keine Einführung | Betonung auf Privatwirtschaft & Datenschutz |
Die USA haben unter der aktuellen Regierung (Stand: April 2025) die nationale Einführung eines digitalen Dollar ausgeschlossen.
Begründung: Gefahr für bürgerliche Freiheiten, Datenschutz und ökonomische Fairness.
„Wir glauben nicht an eine Zukunft, in der die Regierung Ihre täglichen Ausgaben in Echtzeit nachvollzieht.“ – JD Vance, designierter Vizepräsident der Vereinigten Staaten
6.4 – CBDCs als Machtinstrument: Was programmierbares Geld wirklich bedeutet
Die gefährlichste Eigenschaft einer CBDC ist ihre Programmierbarkeit.
Anders als Bargeld kann CBDC:
-
zeitlich begrenzt sein („Sie müssen diesen Betrag bis Montag ausgeben“)
-
zweckgebunden sein („Diese 100 Euro dürfen nur für Lebensmittel genutzt werden“)
-
geografisch eingeschränkt sein („Nur nutzbar in Region XY“)
-
dynamisch blockiert werden („Kein Zugriff bei Verdachtsmoment“)
-
an ESG-Compliance gebunden sein („Nur für CO₂-konforme Produkte nutzbar“)
Das bedeutet: Geld ist nicht mehr Wertaufbewahrungsmittel, sondern ein Konditionierungstool.
Wenn die Regierung – oder eine übergeordnete supranationale Institution – entscheiden kann, wofür, wann und wie Sie Ihr eigenes Geld verwenden dürfen, endet wirtschaftliche Freiheit.
6.5 – Kritik & Gefahren: Von Anonymitätsverlust bis Totalabschaltung
CBDCs werfen fundamentale Fragen auf:
-
Wo endet Transparenz – und wo beginnt Überwachung?
-
Wer entscheidet über „gute“ und „schlechte“ Ausgaben?
-
Was geschieht bei politischer Opposition?
Kritische Szenarien:
-
Spenden an „unerwünschte“ Organisationen → Wallet wird eingefroren
-
Kaufverhalten „nicht nachhaltig“ → Abwertung im ESG-Score
-
politisch kritische Äußerungen → Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten
Technische Risiken:
-
Cyberattacken auf zentrale Infrastruktur
-
Blackouts durch politische Konflikte
-
Massenhafte Fehlsteuerung durch Algorithmusfehler
„CBDCs sind der Traum jeder Regierung, die ihre Bürger vollständig verwalten möchte.“
– Aussage eines EZB-Kritikers (unter Vertraulichkeit)
6.6 – Fallstudien: Was wir aus China, Nigeria und Europa lernen müssen
China
-
Der digitale Yuan ist Pflicht bei Behörden & staatlichen Unternehmen
-
Nutzbar nur mit verknüpfter Staats-ID & Gesichtserkennung
-
Zahlungen für „unerwünschte Produkte“ blockierbar
-
Echtzeit-Überwachung durch KI-Systeme („Sesame Credit“)
-
Hohe Akzeptanz – erzwungen durch soziale Anreize & Sanktionen
Nigeria
-
eNaira wurde eingeführt
-
Bevölkerung lehnte ab → Regierung verhängte Limits für Bargeldabhebungen (2023–2024)
-
Unternehmen mussten eNaira akzeptieren, um weitergeschäften zu können
-
Folge: Schwarzmarkt, Vertrauensverlust, Kapitalflucht
Europa
-
EZB testete über 20 Anwendungsszenarien (u. a. CO₂-begrenzte Zahlung, Ablaufdatum, Alterskontrolle)
-
Öffentliche Kommunikation beschränkt sich auf Datenschutz-Versprechen
-
De facto werden bereits „Soft-Controls“ durch Pilotprojekte eingeführt
6.7 – Gespräch mit einem Ex-Banker: „Die Pipeline zur totalen Steuerung steht“
Ein vertrauliches Gespräch mit einem ehemaligen Investmentbanker aus Frankfurt, der heute in Dubai lebt, bringt es auf den Punkt:
„Die Infrastruktur steht bereits. Wallets sind technisch bereit, Transaktionen programmierbar, Compliance-Regeln integriert. Was fehlt, ist nur der Vorwand, es zu aktivieren.“
Er berichtet, dass europäische Banken in internen IT-Strukturen bereits CBDC-kompatible Schnittstellen implementieren.
Zitat:
„Ein Social-Media-Post heute kann Ihre Kreditkarte morgen blockieren – nicht theoretisch, sondern bereits vorbereitet.“
6.8 – Ihre Optionen: Wie Sie sich gegen CBDC-Abhängigkeit schützen
Es gibt Strategien, sich vor dem Eintritt in eine CBDC-Abhängigkeit zu schützen:
| Maßnahme | Wirkung |
|---|---|
| Firmensitz außerhalb des EU-Raums | Kein Zwang zur Akzeptanz von CBDCs oder staatlichen Wallet-Systemen |
| Offshore-Banking (nicht automatisierter Austausch) | Finanzielle Privatsphäre & Zugriffskontrolle |
| Strukturierte Holdings / Trusts | Schutz durch Eigentumstrennung und multijurisdiktionale Absicherung |
| Sachwerte & physische Assets | Werthaltigkeit außerhalb digital kontrollierbarer Assets |
| Kryptowährungen mit echter Dezentralität | Alternative Zahlung, dezentrale Reserve |
| Citizenship / Residency by Investment | Rechtliche Diversifizierung & Alternativszenarien |
No Borders Founder hilft dabei, diese Systeme rechtlich sauber, individuell angepasst und strategisch abgestimmt umzusetzen.
6.9 – Ausblick: Was als nächstes kommt – und warum jetzt gehandelt werden muss
Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten – aber Sie entscheiden, ob Sie sie passiv erleben oder aktiv navigieren.
Die Kombination aus ESG-Steuerung, Reputations-Scoring und CBDCs ist das Endspiel in der ökonomischen Steuerung freier Gesellschaften.
Nur Unternehmer, Investoren und Familien, die sich frühzeitig absichern, werden weiterhin frei wirtschaften, sich frei bewegen und unabhängig leben können.
No Borders Founder steht dafür:
Für echte Alternativen. Für Freiheit durch Struktur. Für Selbstbestimmung durch Klarheit.
Freiheit stirbt nicht plötzlich – sie stirbt schleichend. Und wer nicht rechtzeitig handelt, hat bereits verloren.
„Die letzte Entscheidung, die Sie treffen können, ist, überhaupt noch Entscheidungen treffen zu dürfen.“ – Alexander Erber
7.1 – Die große Täuschung: Sicherheit als Tauschgeschäft
Sie werden nicht gezwungen.
Sie werden nicht bedroht.
Sie unterschreiben selbst.
So funktioniert moderne Kontrolle – nicht durch offene Gewalt, sondern durch schleichende Konditionierung.
Sie nennen es Transparenz, Klimaschutz, digitale Effizienz.
Doch was es wirklich ist: Verhaltenslenkung, Verfügbarkeitsreduktion, Kontrollarchitektur.
CBDCs, ESG, Reputationsscores – das sind keine losen Einzelteile.
Das ist ein System.
Ein System, das wirtschaftliche Aktivität zur Bedingung macht.
Ein System, das die Autonomie des Individuums abschafft, ohne es zu verbieten.
Ein System, das Sie nicht zwingt zu gehorchen – sondern bestraft, wenn Sie es nicht tun.
7.2 – Was in Europa passiert, ist kein Ausnahmezustand – es ist die neue Normalität
In Deutschland werden Bürger für Likes durchsucht.
In Frankreich brennt jede Woche eine neue Straße.
In Italien werden oppositionelle Bürgermeister kaltgestellt.
In Brüssel werden Parlamente rückabgewickelt, wenn das Ergebnis nicht passt.
Und das alles im Namen der Demokratie?
Nein – das ist ein Systemversagen, das sich als Tugend tarnt.
Es ist eine Verlagerung von Kontrolle in den digitalen Raum, wo keine Rechenschaftspflicht mehr besteht.
Wo das Wort „Hassrede“ reicht, um Ihre wirtschaftliche Existenz zu löschen.
Und wer jetzt noch glaubt, das ginge ihn nichts an, hat bereits das Spiel verloren.
7.3 – Die Wahrheit, die niemand sagt: Wer sich nicht strukturell schützt, wird strukturell ausgelöscht
Es wird keinen Knall geben.
Keinen radikalen Umbruch.
Keine offizielle Abschaffung von Freiheit.
Es wird schleichend, technisch, gesetzlich, plattformgesteuert passieren.
Sie werden merken:
-
Ihre Bank meldet ungewöhnliche Aktivitäten
-
Ihre Firma fällt aus ESG-Rankings
-
Ihre Online-Konten werden gesperrt
-
Ihre Kreditlinie wird gekürzt
-
Ihre Reisefreiheit wird eingeschränkt
Nicht, weil Sie etwas falsch gemacht haben –
sondern weil Sie etwas nicht richtig gemacht haben.
7.4 – No Borders Founder: Kein Versprechen. Eine Struktur. Eine Realität.
In dieser Welt gibt es keine Garantien mehr –
aber es gibt Strukturen, die Sie resilient machen.
No Borders Founder ist keine Gründungsagentur.
Keine Offshore-Spielerei.
Keine Community mit Telegram-Gruppen und Buzzwords.
Wir sind die 1 % der 1 %, die verstanden haben:
Freiheit ist kein Gefühl – sie ist ein System.
Und dieses System bauen wir für unsere Klienten – individuell, rechtskonform, unsichtbar für das System:
-
Internationale Holding-Strukturen
-
Vermögensschutz über vier Rechtsräume
-
Citizenship by Investment & Residenzprogramme
-
Private Banking ohne automatisierten Zugriff
-
Strategien gegen CBDC-Zwang & ESG-Erpressung
„Wer auf einen Richtungswechsel hofft, hat den Kurs bereits aus der Hand gegeben.“
7.5 – Die Entscheidung fällt nicht morgen – sie ist längst gefallen
Wenn Sie diesen Artikel lesen und noch überlegen,
dann stehen Sie nicht am Anfang eines Prozesses –
Sie stehen an der letzten Ausfahrt.
Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt mehr.
Es gibt nur noch jetzt –
und die Entscheidung, ob Sie
Akteur oder Objekt dieses Wandels sein wollen.
7.6 – Das letzte Wort
„Ich habe in meinem Leben Hunderte Unternehmer beraten.
Die Klügsten von ihnen waren nicht die Schnellsten –
aber sie waren die, die rechtzeitig erkannt haben,
wann der Boden unter ihren Füßen instabil wurde.Wer auf Stabilität wartet, wenn das Fundament bröckelt,
wird nicht überleben.Ich bin Alexander Erber – und ich lade Sie nicht ein,
Teil einer Community zu werden.
Ich lade Sie ein, die Kontrolle zurückzugewinnen.“